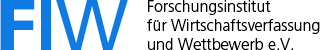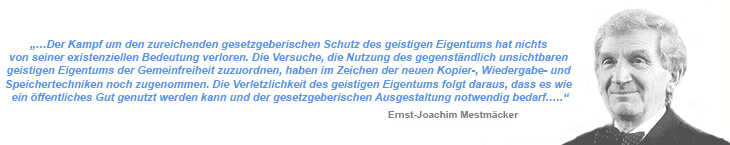30.11.2018
Kurzbericht zur 46. Brüsseler Informationstagung vom 14./15.11.2018 – Neuere Entwicklungen des europäischen Wettbewerbsrechts
D
|
Die 46. Brüsseler Informationstagung begann am 14.11.2018 mit einem Eröffnungsempfang und Abendessen im „La Maison des Brasseurs". Im Rahmen des Abendessens hielt Sir Philip Lowe, ehemaliger Generaldirektor der Generaldirektion Wettbewerb und der Generaldirektion Energie und derzeit Berater der Firma Oxera, eine „After Dinner Speech", in der auch aktuelle Verwerfungen in der globalen Wirtschaftsordnung angesichts der aktuellen U.S.-amerikanischen Verwaltung und der britischen Exit-Bestrebungen zur Sprache kamen. Außerdem räsonierte er über die Unterschiede der Begrifflichkeiten „Nationalismus" und „Patriotismus" anlässlich der vom französischen Präsident Macron in einer Rede zum 100jährigen Ende des 1. Weltkriegs vorgenommenen Unterscheidung und Anspielung auf die Weltlage.
Der Gazprom-Fall - Weiterentwicklung der Preismissbrauchsaufsicht oder Beispiel für Best Practice Competition Enforcement?
Dr. Jörg Karenfort, LL.M, Partner, Dentons Europe LLP
Dr. Johannes Lübking, LL.M, Abteilungsleiter, Generaldirektion Wettbewerb, Europäische Kommission
Lübking erläuterte die Vorwürfe der EU-Kommission gegenüber dem Unternehmen Gazprom, das traditionell der Gasbelieferer in den osteuropäischen Staaten und damit Monopolist sei. Dass die EU-Wettbewerbsregeln auf den Fall Anwendung fänden, sei einem „Lernprozess" gleichgekommen. Gazprom habe eine Strategie der Marktsegmentierung durch vertragliche Gebietsbeschränkungen und gleichwertige Maßnahmen in 8 MOE-Ländern verfolgt. Es habe ein Binnenmarktbezug vorgelegen, da Gazprom eine marktbeherrschende Position auf acht nationalen Großhandelsmärkte für Gas innegehabt habe. Direkte und indirekte Gebietsbeschränkungen hätten es Gazprom erlaubt, in fünf Ländern (Baltischen Staaten, Bulgarien, Polen) überhöhte Preise zu fordern. Die Gebietsbeschränkungen seien als einheitlicher Missbrauch gewertet worden. Die Preise in den mittel- und osteuropäischen Staaten seien zu 22 bis 40 Prozent überhöht gewesen, wobei die Höhen nicht nur auf die Ölpreisindizierung zurückzuführen gewesen seien. Lübking führte weiter aus, dass die Verpflichtungszusagen in effektiver Weise die Beschwerdepunkte adressiert hätten (Polen ausgenommen) und eine zukunftsgerichtete Lösung ermöglichten, mit der die Integration der MOE-Gasmärkte und der Wettbewerb auf denselben verbessert werde. Sie enthielten ein Verbot von direkten und indirekten Gebietsbeschränkungen, einen Mechanismus zur Änderung der Lieferpunkte sowie das Angebot einer neuen Preisanpassungsklausel.
Karenfort bestätigte, dass die Verpflichtungszusagen von Gazprom vom Mai 2018 (auf die Beschwerdepunkte der EU-Kommission) in dem von der EU-Kommission geführten Missbrauchsverfahren ein „maßgeschneidertes Regelwerk" gewesen seien, das sich an die Komplexität des Marktes im MOE-Raum angepasst und zur Anpassung einer komplexen Infrastruktur geführt habe. Allerdings habe die Kommission ein Fehlverständnis von Infrastrukturmängeln an den Tag gelegt. Die Kommission habe keine hinreichende Grundlage für den Vorwurf der Gebietsbeschränkung gefunden. Auch seien die Vorgaben des United Brands-Test hinsichtlich einer missbräuchlichen Preisgestaltung, d.h. eines kostenbasierten Ansatzes, nicht erfüllt worden. Der Beweis, dass Preise im Vergleich zu den angefallenen Kosten überhöht und im Vergleich zu wettbewerbsfähigen Preisbenchmarks ungerecht gewesen seien, sei nicht erbracht worden. In der Verpflichtungszusage sei ein Verstoß gegen den Preishöhenmissbrauch gerade nicht zugegeben worden. Die Preisformeln hätten Gazprom auch nicht einseitig begünstigt. Die Themen seien zudem von energiepolitischen Themen überlagert gewesen. Ein dauerhafter Rechtsstreit zwischen Gazprom und der EU wäre politisch allerdings nicht angemessen gewesen.
Zivilrechtliche „Konzernhaftung"
Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
Kersting sprach sich in seinem Vortrag dafür aus, der zivilrechtlichen Konzernhaftung auch im nationalen Recht Geltung zu verschaffen. Insoweit wolle er gegenüber den Zuhörern einen neuen „Bekehrungsversuch starten". Er begann mit einem Überblick über die Konzernhaftung im Bußgeldrecht und führte aus, dass die Konzernhaftung im EU-Bußgeldrecht bereits seit langem anerkannt sei. Dort hafte die wirtschaftliche Einheit gemäß ständiger Rechtsprechung. Aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive werde ein Verstoß gegen das Trennungsprinzip eingewandt. Dies seien jedoch der falsche Begriff und die falsche Perspektive, so Kersting. Denn nach „richtiger Lesart" begehe die wirtschaftliche Einheit selbst den Verstoß: Aus der Handlungseinheit am Markt folge die Haftungseinheit. Der Haftungsgrund sei allein das Bestehen der wirtschaftlichen Einheit. Eine Übertragung in das nationale Zivilrecht folge schon aus der EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache Kone. Der EuGH verlange, dass jedermann Ersatz seines Schadens verlangen könne und der Effektivitätsgrundsatz und der Äquivalenzgrundsatz beachtet werden. Es hafte, wer gegen die daraus folgenden Pflichten verstoße. Diesen Anforderungen werde nicht genügt, wenn zivilrechtlich nur ein untergeordneter Teil der europarechtlich verantwortlichen wirtschaftlichen Einheit verantwortlich sei. Außerdem seien ansonsten Vermögensverschiebungen zum Nachteil der Gläubiger möglich, etwa durch eine Verlagerung kartellzivilrechtlicher Haftungsrisiken in gering kapitalisierte Töchter. Es bestehe daher auch ein sachliches Bedürfnis für die Konzernhaftung.
Kersting vertrat zudem die Ansicht, dass die Kartellschadensersatz-Richtlinie bereits ein klares Umsetzungsgebot an den nationalen Gesetzgeber enthalte, auch zivilrechtlich die Konzernhaftung einzuführen. Außerdem ließe sich das nationale Recht richtlinienkonform auslegen. Bei mehreren Rechtsträgern hafteten alle Träger des Unternehmens, auch die Schwestern (anders als im deutschen Bußgeldrecht). Der Unternehmensbegriff sei durch ständige Spruchpraxis klar umrissen. Kersting setzte sich auch mit einigen Gegenargumenten auseinander. Im Übrigen sei von dem Urteil im Vorabentscheidungsersuchen Finnland (Rs. C-724/17) Klarheit zu erwarten, ob bereits das Primärrecht die Passivlegitimation regele.
Süßwaren, Tapeten, Rossmann...Was ist der Maßstab für Geldbußen? - Podiumsdiskussion -
Prof. Dr. Konrad Ost, LL.M, Vizepräsident des Bundeskartellamts
Dr. Thorsten Mäger, Partner, Hengeler, Mueller
Prof. em. Dr. Hans Achenbach, Institut für Wirtschaftsstrafrecht, Universität Osnabrück
Ost verwies zunächst darauf, dass das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgebe, dass Bußgeldleitlinien erlassen werden sollten. Allerdings hätten sich in den letzten Jahren kritische Stimmen zu den Leitlinien vermehrt. Zum einen werde eingewandt, dass die Methodik des Bundeskartellamts von der Methodik des OLG Düsseldorf abweiche und dies teilweise in der Lesart des Kartellamts zu niedrigeren Bußgeldern führe (mit der anschließenden Möglichkeit der Verböserung durch das Gericht). Dies schrecke mitunter davon ab, einen Einspruch gegen die Bußgeldentscheidung zu erheben. Zum anderen werde moniert, dass die Zumessungsregeln selbst unklar seien. Ost bezog dahingehend Stellung, dass das behördliche Verfahren ein konsensuales System sei, das - im Gegensatz zum Anklagesystem - einen Abschluss des Verfahrens bilden solle. Außerdem lägen die Bußgeldhöhen beim Kartellamt und dem OLG in der Regel nicht so weit auseinander. Der in der Kritik stehende zu starke Fokus auf den tatbezogenen Umsatz sei vom OLG nicht bemängelt worden. Das OLG habe die Faktoren in den Leitlinien, an die es nicht gebunden sei (daher auch die Möglichkeit der reformatio in peius), gebilligt, störe sich jedoch an der „Mathematisierung". Das OLG habe eher eine strafrechtliche Herangehensweise, orientiere sich aber ebenfalls am Schadenspotential. Durch die Änderungen in der 9. GWB-Novelle müsse darüber nachgedacht werden, ob Änderungen in den Leitlinien erfolgen müssten. Gegebenenfalls müssten diese mehr Öffnungsklauseln vorsehen.
Mäger führte aus, dass die Unternehmen die Gerichte nur bemühten, wenn sie in der Sache mit den Feststellungen des Amtes nicht einverstanden seien. In der Praxis fänden vielfach Settlements statt. Die Verböserung vor dem OLG sei - anders als auf der EU-Ebene - ein virulentes Problem. In Deutschland werde vor Gericht der Fall stets neu aufgerollt, eine Verböserung sei im Grunde die Regel, die viele Unternehmen davon abhielte, überhaupt Einspruch einzulegen. In der deutschen Praxis sei die 10 Prozent-Grenze seit dem Grauzement-Urteil des BGH als Obergrenze zu verstehen. Das Bundeskartellamt wende hingegen einen „selbstgebastelten Bußgeldrahmen" an, der durch die Anwendung der Obergrenze durch das OLG „explodiert". Die „freihändige" Bußgeldfestsetzung durch das Bundeskartellamt innerhalb der 10-Prozent-Grenze müsse überprüft werden, um zu sachgerechteren Lösungen zu kommen. Auch käme ein gesetzliches Verbot der reformatio in peius in Betracht, das Mäger jedoch selbst nicht befürwortete.
Achenbach ergänzte, dass sich das GWB im Hinblick auf Bußgeldvorgaben zurückhalte. Seit der Preismissbrauchsnovelle dürfe das Bundeskartellamt allgemeine Verwaltungsgrundsätze verfassen. Es gehe um eine Ermessensbindung für das Amt, während für die Gerichte keine Bindung eintrete. Dieser unterschiedliche Ansatz werde zum Problem, da das Bundeskartellamt die Konkretisierung der Bußgeldumstände weiter vorangetrieben habe als das Gesetz, welches Achenbach mit einer „Schublade" verglich, die „ mit Inhalt gefüllt" werden müsse. Die Einführung des tatbezogenen Umsatzes sei als erheblicher Fortschritt gegenüber den defizitär gebliebenen gesetzlichen Vorgaben zu werten. Auch habe das Amt in den Leitlinien eine eigene Obergrenze geschaffen, die von der 10-Prozent-Grenze wesentlich nach unten abweichen könne. Damit habe das Amt sein Ermessen in wesentlicher Hinsicht ausgeübt.
Die Abbildung von kartellrechtlichen Risiken im Jahresabschluss
Dr. Ralf Jödicke, Partner, Deloitte GmbH
Jödicke gab in seinem Vortrag einen betriebswirtschaftlichen Einblick in die Gestaltung des Jahresabschlusses in Bezug auf die Darstellung kartellrechtlicher Risiken. Diese fänden sich in der Bilanz zumeist aggregiert unter Rückstellungen für Prozessrisiken oder Rechtsstreitigkeiten, teilweise auch als „sonstige Rückstellungen" gekennzeichnet. Im sog. Anhang müssten die Kartellthemen konkret benannt werden, die in den Rückstellungen aufgeführt worden seien. Einzelschäden müssten nicht genannt werden, sondern nur Gesamtsummen. Lageberichtsangaben, die auf anhängige Verfahren und ggf. zukünftige Risiken hinwiesen, müssten nicht in Rückstellungen erscheinen. Dies entspreche den Vorgaben für die Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (IFRS und HGB). Nach IFRS müssten solche Zahlen in die Bilanzsummen aggregiert werden, wenn es sich um ein verpflichtendes Ereignis aus der Vergangenheit handele. Im dem Fall (bei ca. über 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit) bestehe eine Passivierungspflicht in den Rückstellungen. Bei möglichen Verpflichtungen bestehe ggf. eine Angabenpflicht in Bezug auf eine Aufnahme in die Eventualschulden. Es seien rechtliche oder faktische Verpflichtungen denkbar. Erst bei Schadenseintritt handele es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung. Es stelle sich stets die Frage, ob daraus ein Vermögensabgang wahrscheinlich werde. Ein erstinstanzliches Urteil stelle immer eine gegenwärtige Verpflichtung dar.
Hinsichtlich der Wertdarstellung in einer Rückstellung komme es auf eine „bestmögliche Schätzung" (best estimate) zum Bilanzstichtag (Erfüllung der Verpflichtung oder deren Übertragung) an. Gewährleistungsrückstellungen erfolgten nach Maßgabe des Erwartungswerts. Bei Einzelrisiken müsse man den Wert mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Im Unterschied dazu nehme man nach HGB-Anforderungen den Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und der gebotenen Vorsicht sinnvoll erscheine. Dieser Ansatz sei ermessensbehafteter als der nach dem IFRS-Standard. Er müsse allerdings keiner Drittüberprüfung statthalten, sollte aber sachgerecht sein. Rechtsgutachten seien nur erforderlich, wenn die Geschäftsführung, die für den Abschluss verantwortlich sei, nicht selbst eine Entscheidung treffen könne. Nach dem Bilanzstichtag dürften nur Ereignisse berücksichtigt werden, die „werterhellend" und nicht „wertbegründend" seien.
Neuere Entwicklungen in der europäischen Fusionskontrolle
Dr. Marc Zedler, LL.M., Generaldirektion Wettbewerb, Europäische Kommission
Zedler berichtete zunächst über die Zahl der Anmeldungen in der Europäischen Fusionskontrolle im Zeitraum von 2000 bis 2018. Die Anmeldungen in 2017 seien mit 380 auf dem zweithöchsten Stand seit 2007 (2007: 402 Anmeldungen). Der Trend der Fallzahlen sei anhaltend steigend. Dies liege unter anderem an der Ausweitung des vereinfachten Verfahrens in 2014. Zedler berichtete über einige Interventionen seitens der Kommission in diesem Jahr. Von Januar bis September 2018 habe es einige bedingte Freigaben in Phase I und Phase II gegeben, eine einzige Aufgabe des Vorhabens in Phase II und keine Verbotsentscheidung. Hinsichtlich der von der Kommission zugrunde gelegten Schadenstheorien habe der Schwerpunkt auf der Untersuchung möglicher Preisanstiege aufgrund horizontaler, nichtkoordinierter Effekte gelegen. Es seien aber auch Auswirkungen auf Innovation, koordinierte Effekte und nicht-horizontale Effekte, meist in Kombination mit Preiseffekten, untersucht worden. Bei den in Frage kommenden Abhilfemaßnahmen (auch schon in Phase I) bevorzuge die Kommission eine Veräußerung eigenständiger Geschäftsbereiche im Umfang der sich überschneidenden Tätigkeiten. Die Veräußerung lediglich einzelner Produkte könne sich als unzureichend erweisen. Darüber hinaus könnten weitere Absicherungen erforderlich sein (z. B. "Upfront buyer", „Fix-it-first"). Zedler ging im Anschluss auf aktuelle Gerichtsurteile ein und schloss mit einigen „Hot Topics", z. B. mit der Frage, ob ein Gemeinschaftsunternehmen nach dem Zusammenschluss voll-funktionsfähig sein müsse, um in den Anwendungsbereich der Fusionskontrollverordnung zu fallen (z. B. Gemeinschaftsunternehmen nach Austria Asphalt), was der Gerichtshof bejaht habe. Dazu gehöre auch die Reichweite eines Verstoßes gegen das Vollzugverbot ("Gun Jumping") am Beispiel des Urteils des EuGH in der Rechtssache Ernst & Young, der das Vollzugsverbot auf zusammenschlussbegründende Maßnahmen (Kontrollerwerb) beschränkt habe. Kontrovers werde auch Innovation als Prüfungsgegenstand in der Fusionskontrolle und damit eine Erweiterung der herkömmlichen Schadenstheorie anhand einiger Fälle im Pharmasektor diskutiert.
(Durch Klick auf den jeweiligen Referentennamen öffnet sich die hinterlegte Präsentation).